 |
Nicholas Hoult als Marcus Brewer,Filmszene aus
„About a boy“ (2002; Regie: C.& P. Weitz) |
In einer Art konzeptuellen Gegenbewegung zur Theorie des psychischen Traumas und seiner oft leidvollen, anhaltenden Folgen ist während der letzten fünfzehn Jahre des psychotherapeutischen Diskurses verstärkt der schon viele Jahrzehnte alte Begriff der Resilienz
zu neuer Blüte gelangt. Er ist am besten erläuterbar anhand von Kindern, deren frühe Umgebungsbedingungen widrig waren, und die dennoch nicht nur durchhielten, sondern sich sogar weiterentwickelten. Es gibt Kinder, deren Vater früh abgehauen ist, deren alleinerziehende Mutter depressiv, alkoholisiert oder vollesoterisch dahinleidet und die wenig finanzielle, Großeltern- und peer-group-Ressourcen haben; Kinder, die einfach Pech haben im Vergleich mit ihren Klassenkameraden und die zudem oft noch entwertenden Hänseleien ausgesetzt sind, die ihrer no-win-Situation die Krone aufzusetzen scheinen … und dennoch entfalten sie sich. Nicht wie eine leicht mickerige, schon von Anfang an im Strauß des Lebens als schwächlich auffallende Blume, die dann doch noch einigermaßen und wider Erwarten aufblüht, freilich mit ihrer kleinen A-Körbchen-Blüte von den anderen Blumen in der Vase optisch eindeutig abgehängt wird. Sondern es gibt da Exemplare, von ihren frühen Entwicklungsbedingungen her malträtiert, die sogar andere überstrahlen und charakterlich beeindruckende Persönlichkeiten werden. Granitpflanzen sozusagen. Es sind die seelischen Steinböcke in der Vielfalt der Arten, die in ihrer Kindheit mit ganz wenig Seelennahrung auskamen und sich oft sozial in unzugänglichen, isolierten Terrains aufhielten, einsam waren und geduldig vor sich hin ackerten. Platon soll es einmal als Entwicklungstrieb der Psyche bezeichnet haben, dass die erotische Selbstentfaltung so einiges bewirken könne und, vor allem, gegenläufige, hemmende und defizitäre Tendenzen zu überflügeln wisse.
Marcus Brewer verkörpert so einen Typus, ein zwölfjähriger Junge im Film About a boy, der durchhält, ansprechbar bleibt und sensibel und schließlich sogar einen väterlichen Freund findet, welcher von dem in der Schule gehänselten Jungen mindestens so viel lernt wie Marcus selbst von ihm. Im Film geht es viel um Scham. Eigentlich, jedenfalls in meiner Erinnerung, fast dauernd. Und wie sich vor allem die beiden Protagonisten, der zunehmend fürsorgliche Gefühle entwickelnde Weiberheld Will und der Sohn einer ökologieverfallenen Therapeutin, Marcus, gegenseitig aus Beschämungssituationen heraushelfen, ohne große Worte dazu absondern zu müssen. Sie waren zu Männern geworden.
Patienten mit grauenvollen Biographien, die seelisch überlebten, haben mich bei meiner psychotherapeutischen Arbeit immer wieder tief beeindruckt und einen besonderen Respekt vor ihnen hinterlassen. Einer von ihnen war Josef. Er war mit 18 mutterseelenallein aus Osteuropa gekommen, offiziell um zu studieren, was er auch mit Bravour, als erster Akademiker seiner Herkunftsfamilie, tat, und inoffiziell, um den Beschämungen seiner Kindheit zu entfliehen. Als Josef seine Homosexualität entdeckte, war er knapp im Alter von Marcus gewesen; er war anders und das merkte nicht nur er, sondern auch seine Umgebung. Im Dorf, in dem er aufgewachsen war, hatte seit diesem Zeitpunkt keine Ruhe mehr geherrscht. Abends gab es fast täglich Anrufe bei ihm zuhause. Mal von einem Lehrer, mal vom Pfarrer, mal von einem Nachbarn, mal von einem besorgt-gehässigen Kunden seines Vaters, der einen großen Installateurbetrieb führte. Die Anrufe wurden stets von seinem Vater entgegengenommen. Handys gab es damals noch nicht, so dass Josef vom ersten Stockwerk aus, wo er sein Zimmer hatte, den Vater durch die tannengrün lackierten Holzlatten des Treppengeländers hindurch in der immer gleichen Blickperspektive konnte stehen sehen und mit den Anrufern reden hören; seines Vaters Gesicht, seine Miene, seine manchmal mit der linken Hand geballte Faust brannten sich ein in Josefs Erleben. Nie hörte er den Vater eine Bemerkung, einen Satz, ein Wort zu seiner Verteidigung sagen. Es war immer das gleiche Ritual. Der Vater buckelte, teilte mit den wechselnden Anrufern die Empörung über diesen Abschaum jugendlicher Devianz, diesen Störenfried der dörflichen Grundgesinnung, diese Schande für eine angesehene, halb deutschstämmige, seit zwei Generationen endlich integrierte Familie. Unmittelbar nach dem Auflegen des Telefonhörers, das ein Angstgeräusch erzeugte, hörte er den Vater rufen. Dann musste er runterkommen; er stand ja schon bereit, am Treppengeländer, er harrte diesem Moment schon seit dem späten Mittag entgegen, es ging alles schnell. Die Hose runterlassen und sich den Riemen geben lassen. Die Mutter ging dann in die Küche und schloss hinter sich die Tür. Sie bedauerte ihren Nachkömmling von Vieren, der vom Vater schon am Tage seiner Geburt als überflüssig bezeichnet worden war. Aber getan hat die Mutter für ihn nichts. Jahr für Jahr, Woche für Woche, unterzog er sich dem frühabendlichen Ritual. Wenn die Familie Besuch hatte, sowie an Feiertagen, fiel es aus. Da wurde im Wohnzimmer der Tisch eingedeckt und der Riemen blieb im Arbeitszimmer, wo Josef ihn im Laufe der Jahre selbst hatte holen müssen, ohne Licht anzumachen, weil der Vater wusste, dass sich Josef, seit er dort einmal von ihm von hinten überrascht und geschlagen wurde, vor dem dunklen Hausgang, der zum Arbeitszimmer führte, fürchtete. Er sagte mir, das Schlimmste seien nicht die Schläge gewesen, sondern die sich regelmäßig daran unmittelbar anschließende verbale Gewalt. Er wollte die Worte seines Vaters mir nicht wiederholen. Zwei Jahre lang nicht. Sie schmerzten noch immer, einen attraktiven 46jährigen Mann, der sich durch ein anstrengendes Studium gekämpft hatte, seine für einen Mann nur mäßige Körpergröße beim Knüpfen erster partnerschaftlicher Kontakte, bei dem er schon Ende 20 war, bewältigen musste, und der jedes Jahr einmal im Sommer nachhause fuhr, in das Land, das er liebte und das ihm sowenig Nahrung gegeben hatte, stattdessen ihn mittels Demütigungen und Belehrungen versucht hatte, aus dem Regenbogenland herauszupeitschen und umzudrehen, so wie es in Japan mit den Füßchen der kleinen Mädchen gemacht wurde, damit die nicht zu groß würden. Diese jährlichen Besuche bei seiner Familie versetzten ihn bereits Wochen vorher in eine Art Panik. Die Wut auf den mittlerweile fast 90 jährigen Vater, der Josefs Homosexualität nie mehr seit dessen Auszug erwähnt hatte, vermischte sich mit Angst vor ihm, denn nicht einmal der Weg vom Flughafen nach hause durfte von ihm gewählt werden, der Vater schrieb vor. Seine Sätze wurden unterbrochen, seine mutige berufliche Selbständigkeit wurde belächelt, und sein Privatleben wurde wegen Irrelevanz komplett tabuisiert.
Josef war ein bemerkenswerter Mann. Von hoher Sensibilität nicht nur für sich, sondern auch für die anderen. Er machte sich Gedanken, ohne dauernd darüber reden zu müssen. Über seine zahlreichen treuen Freunde und Freundinnen, über politische Fragen, über den Verlauf seiner HIV - Infektion, die ihn schließlich zu mir geführt hatte, und von der er mir erst nach mehreren Sitzungen hatte erzählen können – als komme sie noch einmal zurück, die ganze Scham, mit der sein Vater ihn damals infiziert hatte. Er hatte eine klare, intelligente, gepflegte Sprache, eine sehr zugewandte, auf sein Gegenüber fokussierte Art, einer der höflichsten, dabei nicht verklemmten, sondern natürlich freundlichen Menschen, die mir begegnet sind. Er pflegte das Leben und gab ihm die Ehre. Ich habe bei ihm nie auch nur den Hauch von Hybris, Arroganz oder Entwertung gegenüber Ungebildeten, Heterosexuellen, Armen oder Reichen, Dicken oder Supereleganten wahrnehmen können.
Eine dauerhafte Partnerbeziehung ist er nie mehr eingegangen. Dafür haben die väterlichen Peitschenhiebe, die ganze Arbeit in Josefs Vorratskammer an Urvertrauen geleistet hatten, gesorgt.
Aber noch gebe ich nicht auf, Josefs HIV – Infektion als neue Herausforderung des Schicksals an seine Resilienz zu interpretieren. Das innere Nadelör: trotz Schwulsein sich liebenswert fühlen und das Ganze auch noch mit der Infektion im Selbstwertgepäck. Sein Schicksal drängte auf Annahme der Herausforderung. Ich bin vorsichtig zuversichtlich. Denn er gehört zur Gattung der Granitpflanzen. Die wachsen selbst dort, wo andere nicht hinschauen mögen.
* Textpassage und Photographie aus:
Salzburg und Berchtesgaden. Ein Taschenbuch für Reisende und Naturfreunde. Franz Anton von Braune. Wien, 1821. Bey Carl Ferd. Beck
* Textpassage und Photographie aus:
Salzburg und Berchtesgaden. Ein Taschenbuch für Reisende und Naturfreunde. Franz Anton von Braune. Wien, 1821. Bey Carl Ferd. Beck

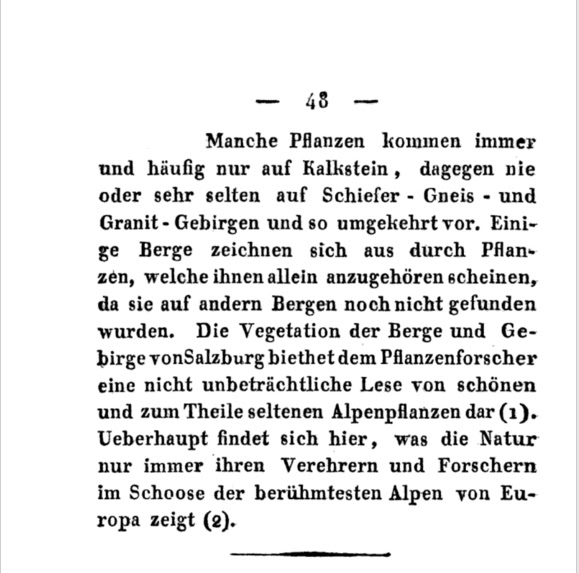
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen